
Die Erzählung beginnt mit einem allgemeinen Statement: »Man behaupte nie, bis ins Letzte über ein menschliches Herz Bescheid zu wissen. Mir enthüllte sich einmal […]« (S. 5) – schon sind wir mitten im erzählerischen Setting angekommen: ein Ich wird zu uns sprechen, ein Ich, welches sich am Rand der Szenerie bewegt, um uns von seinen Wahrnehmungen zu erzählen, die wir ob ihrer Subjektivität durchaus mit Vorsicht genießen dürfen – nichts anderes sind wir von Henry James und seiner Vorliebe für die Situation der reflektierten Beobachtung gewohnt.
Dieser imaginierte Beobachter weist in »Louisa Pallant« noch eine weitere Besonderheit auf: Er ist nicht bloß außen vor, es schieben sich auch Jahre, Jahrzehnte vielleicht, zwischen seinen Akt des Sprechens und die drei Zeitebenen, in der sich die dargestellten Ereignisse zutragen. Ein erster Hinweis darauf steckt in der Wendung »Der Leser wird bemerkt haben, dass ich den Dingen gern auf den Grund gehe, um sie mir erklären zu können […].« (S. 21) Implizit wird hier außerdem der Grund zu sprechen des Ich-Erzählers thematisiert: Er will die Ereignisse und die dadurch evozierten Emotionen ergründen; unverkennbar ist es ein auktoriales Ich, ob seiner Wendung an den Lesenden. Auktorial, wiewohl er an keiner Stelle in das Bewusstsein anderer Figuren eindringt, sondern einzig und allein in typischer James’scher Manier das Verhalten und die Worte der anderen Protagonist*innen darlegt – geht denn das?
Ja.
Das ist in der sogenannten Ich-Auktoriale, die sich zwischen erzählendem und erlebendem Ich aufspannt, durchaus eine Möglichkeit: Das ältere Ich erzählt – eintauchend in Vergangenheiten – von jenem Damals, welches es zusätzlich mit dem heutigen Wissenstand kontrastiert, wodurch solche Sprünge in der Zeit entstehen wie der nachfolgende: »Es kam mir nicht in den Sinn, mich zu fragen, ob […].« (S. 21)
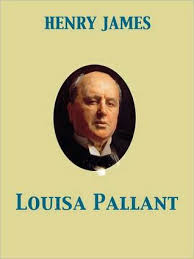
Möglicherweise handelt es sich bei diesem Ich sogar um einen unzuverlässigen Erzähler, wie das von James so gerne (und manchmal fast exzessiv) gepflogene Hintanhalten von Details zur Spannungssteigerung andeutet. Hinzu kommt, dass James sein erzählendes Ich durchaus mit Ironie auf jene Ereignisse eines Jahres blicken lässt – oder vielmehr auf den daran beteiligten Archie, des Erzählers Neffen, gerade eben aus den USA eingetroffen, den unser Erzähler während einer Europa-Tour schützend begleiten solle.
Als sich der junge Archie der bildhübschen Linda emotional annähert, heißt es über des Ichs Blick auf das junge Paar, dessen Dialog mit Pausen wohldurchzogen ist: »[…] zumal meines Neffen Reden, von seinem Denken ganz zu schweigen, durchaus nicht ohne Erholungsphasen auskam […]« (S. 22), weshalb Linda ihm daher ab und an vorlese: »Ich weiß nicht, woher sie ihre Bücher hatte – ich versorgte sie nie mit welchen, und er ganz gewiss auch nicht. Er war kein Leser, und ich wage zu behaupten, er muss dabei eingeschlafen sein.« (S. 23)

Mit diesen Details umreißt James in wenigen gekonnten Strichen seine Figuren, die Beobachteten wie den Beobachtenden, und überlässt es uns, daraus Schlüsse über ihr Agieren, ihre Vertrauenswürdigkeit, ihr emotionales Empfinden zu ziehen. So wissen wir durch das Ich, dass Linda die Liebenswürdigkeit in Person ist; doch wir erfahren auch, dass ihre Mutter sie für ein Biest hält, fähig zu Mord, weshalb die Mutter den jungen, unbedarften Archie vor ihrer Tochter warnen will. Eine Handlung, die sie dem Ich-Erzähler ankündigt, der seltsam zögerlich darauf reagiert. Statt sogleich das Kurhotel mit seinem Zögling zu verlassen, sinnt er darüber nach und vermutet eine Finte der älteren Dame, einen manipulativen Schachzug ihrerseits. Dies kommt nicht von ungefähr, wissen wir doch, dass das Ich einst erfolglos um die Mutter warb, welche jedoch einen anderen – »bloßer Fleischtöpfe wegen« (S. 8) – heiratete.

Energisch verwehrt die Mutter jede Parallelsetzung ihrer Person mit derjenigen der Tochter, denn letztere übertreffe sie an Kälte bei Weitem. Noch eine vierte Person spielt eine Rolle in dieser Erzählung – des Ichs Schwester, Archies Mutter –, und ihre Rolle für die Interpretation des Inhalts ist wesentlicher, als sie auf den ersten Blick dünkt, denn ihr gehört der letzte Satz: Kaum habe das Ich ihr die Ereignisse vorgetragen, »[…] (so inkonsequent sind nun einmal die Frauen) nichts könnte schärfer sein als ihre Missbilligung Louisa Pallants.« Eine auf den Punkt gebrachte Charakteristik dieser Figur, samt dem bei Henry James konstant wiederkehrenden Vorwurfs des Wankelmuts. Zudem bewirkt dieser Schlusssatz eine Umdeutung des bisherigen Inhalts. Ein Erzählmanöver, das Henry James ebenso gerne zur Spannungssteigerung nutzt wie die ewig angekündigte Lüftung eines Geheimnisses, Schleier um Schleier. Louisa – eine Figur, die zuvor als einst hintertriebene Kokotte, nun geläutert, doch eventuell eine gehässige Mutter gekennzeichnet wurde – hat umgedeutet zu werden. Es ist des Ich-Erzählers Geschichte mit ihr, die uns in die Irre führte, denn im Absatz davor wird uns der Mutter angeblich gehässiger Verdacht bestätigt: Linda ermordet zwar niemanden, doch heiratet sie die Geldbörse: einen Kerl, der die Anforderungen ihrer Wunschliste nach Wohlstand und Sicherheit erfüllt, selbst wenn er sonst weder Hirn noch Herz, nicht einmal Charme zu bieten hat.
Und Archies Mutter? Statt dankbar zu sein, dass Archie der Schmerz einer unglücklichen Liebe erspart blieb, sein Vermögen hätte Linda niemals genügt, verurteilt Archies Mutter die Einmischung Louisas, wiewohl Linda als Schwiegertochter nichts außer einem hübschen Lärvchen zu bieten hat. Wer, so scheint der Ich-Erzähler uns final zu fragen, ist nun die gehässigere Mutter?

Mit welcher Enthüllung Louisa den jungen Archie en detail in die Flucht schlug, wissen wir nicht. Die angedeutete Information wird nie erzählt, sie bleibt eine Auslassung, die der Spannungssteigerung dient, weshalb ihre Deutungsvarianten folglich changieren: Ist Louisas Agieren Taktik, entspricht ihr Wort der Wahrheit, ist sie wirklich besorgt und ihre Tochter der Teufel? Oder ist die Mutter einzig eifersüchtig auf die Anerkennung, welche die schöne Junge an ihrer Seite erhält, und macht sie deshalb schlecht? Will sie die bestmögliche Partie für Linda? Was insgeheim auch kaum verwundern würde, in dieser Gesellschaft gegen Ende der 1870er-Jahre, in der Charme und die Schönheit der Oberfläche das einzige sind, was an einer Frau je Wertschätzung erfahren wird und ihre Zukunftschancen definiert.
Alles mögliche Deutungsvarianten, doch wie Henry James schon zu Beginn vermerkte: »Man behaupte nie, bis ins Letzte über ein menschliches Herz Bescheid zu wissen.« (S. 5) Es gibt eben keine objektive Wahrheit. Weder über Louisa noch Lina, weder über Archie und seine Mutter, nicht einmal über den Ich-Erzähler. Doch sagt die Interpretation, die Sie vorziehen, stets etwas über Sie aus. Ich glaube Louisa – und Sie?
Quelle:
James, Henry: Louisa Pallant. In: Tagebuch eines Mannes von fünfzig Jahren. Zürich: Manesse Verlag 2015. S. 5–63.