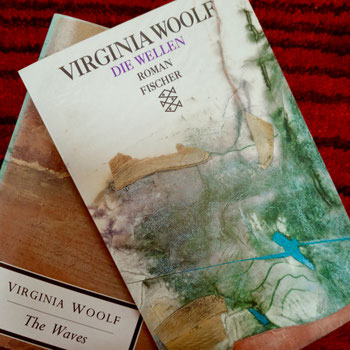
Wer die Lektüre des Prosawerks »Die Wellen« von Virginia Woolf beginnt, wird sogleich erkennen, welch außergewöhnliche literarische Arbeit er oder sie da in Händen hält. Vielleicht mag dem einen oder anderen unbedarfteren Lesenden entgehen, dass bereits der Beginn mit dem Strukturmittel der narrativen Helfer gearbeitet ist, die als Licht oder Wind an die Stelle einer erzählenden Figur treten, jedoch die gleiche Funktion ausfüllen: Sie erzählen, was sich ereignet, sie beleuchten die Geschehnisse. Womöglich mag er oder sie in Unkenntnis des Fachbegriffs ›Narrative Helfer‹ deren Wirkung während der Lektüre beschreiben und daher von einem Tableau sprechen, welches Woolf vor den Augen des Lesenden ausbreitet:
Wir betreten die Szenerie in unserer Imagination aufgrund einer bildhaften Darstellung. Wir gleiten vom Horizont, an dem bald die Sonne aufgehen wird, mit den Wellen über die Meeresoberfläche an den Strand. Wir folgen dem Jagen und Haschen der Wellen, bis sie sich brechen. Wir sehen, wie diese Bewegungen sich fortsetzen im Flug der Vögel, welche erst im Garten innehalten und ihre Lieder trällern: just in dem Baum vor dem offenen Schlafzimmerfenster. Sanft bläht der Wind den Vorhang, er bringt den unablässigen Gesang der Vögel mit sich.
Diese Szenendarstellung mag heutige Lesende an eine Kamerafahrt erinnern, schließlich weist jene das gleiche Bauprinzip wie ein Narrativer Helfer auf.
Das Kreuz mit der Röhre
In Woolfs Roman »Die Wellen« ist das Strukturelement Narrativer Helfer nicht in Form eines knappen Kunstgriffs zum Einstieg in ein Erzähluniversum gearbeitet, sondern es kehrt insgesamt neun Mal wieder. Daher ist es durchaus als ein eigenes, bestimmendes Element in diesem Erzählwerk zu sehen. Mehr noch: Ich bin überzeugt, man kann es sogar einen eigenen Erzählstrang nennen; glaubt man an Nature Writing. Denn just dies ist der Inhalt jenes ersten Strangs, der manchem bei oberflächlicher Betrachtung vielleicht inhaltlich recht dürftig erscheinen mag, lässt er sich doch in dem lapidaren Satz zusammenfassen: ›Die Zeit vergeht, sie streift vom Sonnenaufgang bis zum -untergang, und Fauna sowie Flora reagieren darauf‹. Der Einschätzung, diese kursiven Passagen als eigenen Erzählstrang zu werten, wird wohl kaum jemand widersprechen. Mehr in die Haare geraten dürfte man sich bei der Frage, ob er außerdem ein Exempel für eine Kommunizierende Röhre ist.
Was dafür spricht, ist das Faktum, dass das Figurenarsenal beider Stränge voneinander divergiert – Natur vs. sechs menschliche Protagonist*innen. Ebenso, dass beide Erzählstränge einander ergänzen. Würde einer davon fehlen, hätten wir in der Gesamtheit eine gänzlich andere Narration, denn die Betonung des Lebenslaufes und seines Vergehens würde fehlen. Dennoch kann man beide Erzählstränge auch für sich stehend lesen: Erzählt der erste vom Vergehen der Zeit im Laufe eines Tages, schildert er, was dabei zu beobachten ist, beleuchtet der zweite Momentaufnahmen aus dem Leben von sechs Freund*innen. Somit wären die grundsätzlichen Kennzeichen Kommunizierender Röhren erfüllt.
Der zweite Erzählstrang kreist um sechs sprechenden Personen, die um einander sowie um einen siebten namens Percival tanzen, der niemals spricht. Sind die Freunde in Abschnitt 1 noch jugendlich, kämpfen sie in Kapitel 9 bereits mit Konsequenzen des Alterns und des nahenden Todes. Auch nimmt ihre Anzahl beginnend mit Abschnitt 4 ab: In diesem erreicht die Sonne ihren Zenit – der Unfall Percivals reißt den Ersten aus der Freundesgruppe. Über diesen Tod, der in das kleine, prosaische Glück der wieder vereinten Freunde einbricht, heißt es: »Der Himmel sei gelobt, dass wir diese Prosa nicht zu etwas Poetischem aufbauschen müssen.« (205) Später verkleinert sich durch den Selbstmord Rhodas die Gruppe nochmals.
Nichts ist wie es scheint.
Bislang haben wir hier von einem ersten und einem zweiten Erzählstrang gesprochen, als wäre letzterer homogen, doch ist er in sich zersplittert. Er erinnert ein wenig an ein Kaleidoskop.
Das fällt bereits im ersten Kapitel auf: Die Kinder geben einander den Erzählfaden im assoziativen Spiel in die Hand. Endet der Satz des einen, erzählt das nächste Kind weiter. Und dieses Weitererzählen ist durchaus wortwörtlich zu nehmen. Denn die Passagen dieses Erzählstrangs bestehen ausschließlich aus direkten Reden Sie werden dominiert von Wendungen wie ›ich sehe / höre / spüre‹ sowie von der Zeitangabe ›jetzt‹.
Jeder der neun Abschnitte steuert auf einen Höhepunkt zu. Ähnlich den Wellen, die herbei rollen, bis sie sich brechen, wird auch die inhaltliche Konsequenz eines Ereignisses erst im nachfolgenden Redebeitrag verständlich. Zum Beispiel küsst Jinny Louis. Danach folgt: »Alles ist zerbrochen.« (S. 11); eine Replik auf die Veränderung, die dieser Kuss im Zusammenspiel der Freund*innen bewirkt. Besonders auffallend ist in diesen neuen Abschnitten auch das unterschiedliche Heranwachsen der Mädchen und der Jungen und die implizite Kritik Virginia Woolfs daran: Welche Bildung wird jungen Menschen offeriert (Mädchen: Nadelwerk und die Fähigkeit zu unterhalten; Jungs: klassische Bildung), wohin wird ihr Blick gelenkt (Mädchen: auf die Jungs; deren Streben gilt aber Karriere, Ruhm, Ehre, Freundschaft und Männerbünde), wie tritt Sexualität in ihr Leben (Mädchen: nicht existent, falls doch ist sie bedrohlich, sie begegnen ihrem In-der-Welt-Sein wie junge Fohlen, heißt es, die scheu ein wenig Zucker naschen; Jungs: Sehnsucht zuerst auf Jungs ausgerichtet, was als zerstörerische Welle beschrieben wird, dann auf das Erfüllen eigenen Verlangens), wie dominant ist die Gruppe, wie groß der Wunsch dazuzugehören (Mädchen: geringer, alles kreist um die Akzeptanz durch Männer; Jungs: Männerbünde sind ihr Zentrum, Verbindungen sind das A und O ihres (beruflichen und gesellschaftlichen) Seins).
Noch ein Wort zu den titelgebenden Wellen, die auch als Metapher für andere Lebenselemente wie Zuneigung, Eifersucht fungieren: Sie stehen für das Leben an und für sich. In Abschnitt 9, dem Sonnenuntergang, breiten sich in der Zeit des Alterns »Wellen von Dunkelheit« aus (184f). Das Leben, so wird darin räsoniert, könnte irgendwann einmal in ferner Zukunft ein Genuss sein und als solcher betrachtet werden: Dann könnten erzählende Figuren es auch wie Weintrauben an der Rebe abbrechen und zur Begutachtung übergeben, doch das sei gegenwärtig noch unmöglich (185). Nur in Geschichten sei ein Sprechen über das Leben vorstellbar, und nur das Zusammenspiel aller Geschichten ermögliche Wahrheit, denn keine allein könne darauf Anspruch erheben. So heißt es in Bernards Worten: »[…] um Ihnen mein Leben zu geben, muß ich Ihnen eine Geschichte erzählen – und es gibt so viele, so sehr viele – Geschichten aus der Kindheit, […] der Schule, von Liebe, Ehe, Tod […] und keine von ihnen ist für sich genommen wahr.« (186) Es verhält sich also wie mit den Wellen: Auch sie machen erst in ihrer Gesamtheit den Ozean aus.
Sechs? Oder doch nur eine?
Die sprechenden Personen tragen sechs Namen, und sie sprechen in diesem Roman wahrhaftig. Nacheinander. Abwechselnd. Was sie nicht in ihren direkten Reden von sich geben, das wird nie erzählt. Im ersten Abschnitt wird noch angedeutet, dass sie alle in einem Raum sind, wohl in einem Schlafzimmer, im Halbdunkel, denn das Rouleau bewegt sich leicht. Sie wechseln einander im Sprechen ab; in späteren Abschnitten sind manchmal nur zwei oder drei der Freund*innen anwesend, die Orte variieren sich, doch stets spielt die umgebende Natur eine Rolle. An wen sich ihr manchmal fast monologisches Sprechen richtet, wird nicht prononciert erwähnt. Es wirkt, als würden sie einander ihre Geschichte erzählen, und der Lesende sei nur zufällig ein Hörender an der Wand, doch keineswegs involviert, auch nicht durch Identifikation. Diese wird nämlich von Beginn an torpediert.
Wobei … Es kann ja nicht einmal als gesichert gelten, ob es sich wirklich um sechs Individuen handelt! Final sagt Bernard: »[…] ich bin nicht eine Person; ich bin viele Menschen […]« (215) An dieser Stelle könnte es noch als metaphorische Aussage gelesen und dahingehend interpretiert werden, dass das Ich eben niemals eine einheitliche Kategorie sei, doch geht Bernards Rede wie folgt weiter: »[…] ich weiß nicht genau, wer ich bin – Jinny, Susan, Neville, Rhoda oder Louis; oder wie sich mein Leben von ihrem unterscheiden ließe.« (215) Was sich hier noch immer als Aussage im übertragenen Sinn lesen lässt, erfährt eine weitere Akzentuierung einige Seiten später: »Denn dieses ist nicht ein einziges Leben; und ich weiß auch nicht immer, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, Bernard oder Neville, Louis, Susan, Jinny oder Rhoda – so seltsam ist die Berührung des einen mit dem anderen.« (219) Es sind nicht nur die Ich-Grenzen, die folglich fluktuieren, es sind auch die Zuschreibungen männlich/weiblich. »Die Wellen« ist folglich auch ein Roman über die Natur der Identität, und Woolf zeigt darin auf wahrlich grandiose Art und Weise, wie Identität und Sprache miteinander verwoben sind.
Gerade in den späteren Abschnitten kreist der Inhalt verständlicherweise um das Nicht-Gelebte: »Ich sagte mir, das Leben sei unvollkommen gewesen, ein nicht beendeter Satz.« (221) Ebenso wird die Erfahrung thematisiert, dass zum eigenen Leben andere Menschen gehören, »Schatten von Menschen, die man hätte sein können; ungeborene Ichs.« (226). Spätestens an diesen Stellen sollte sich einem entschlüsseln, weshalb man die Protagonist*innen zu Beginn kaum als Individuen begriff. Dies geschah nicht nur, da man sie nicht handelnd erlebte, sondern das diffuse Gefühl für sie ist künstlerische Absicht, ebenso wie ihre verschwimmenden Grenzen.
Die dritte Ebene
Charakteristisch für Kommunizierende Röhren ist, dass erst in einer Interpretation, bei der beide ›Röhren‹ in Beziehung zueinander gesetzt werden, ihr Wesentliches erfasst werden kann: Eine dritte Erzählung entsteht durch diese Nuancierung in ihrer Bedeutung.
Das Zusammenspiel der beiden Erzählstränge in »Die Wellen« kreist um die Aspekte Beleuchtung / Schatten und Zeit zu Entstehen / zu Vergehen. Der erste Erzählstrang setzt im Zusammenspiel mit dem zweiten den Akzent darauf, dass es natürlich ist: Wachstum und Tod wird als Teil des Lebens begriffen. Alle Naturbilder aus dem ersten Strang kehren im zweiten als bildliche Aussagen wieder: »Das Fallen des Tropfens ist die Zeit, die sich zu einem Punkt zuspitzt.« (S. 144) Erst das Licht (in Abschnitt 4) bringt die Schatten (den Tod), sie ballten sich zuvor im Hintergrund, nehmen stetig zu und fluten in die Konsequenz des Verlusts. Oder als die Sonne ihren Zenit schon überschritten hat, schräg steht, der Wellengang zunimmt, heißt es: »Ich werde herumgeworfen werden; emporgeworfen und niedergeschleudert zwischen den Menschen, wie ein Schiff auf See.« (S. 138)
Noch eine weitere Ebene kommt im Zusammenspiel beider Erzählstränge zum Tragen: Wie im ersten durch die Bewegung des Lichts und durch die Kraft des Windes, die Aufmerksamkeit gelenkt wird, so fällt auch in den Momentaufnahmen des zweiten Erzählstrangs der Blick auf dieses oder jenes Element, lässt anderes jedoch außer Acht. Das Leben, so könnte man daraus folgern, ist wie der Blick auf das Meer, stünde man an einem Strand: Das Augenmerk wird jener Wellenkrone gelten, die im Licht der Sonne glitzert, aber nicht der Muschel, die hinter einem im Sand liegt. Die Aufmerksamkeit folgt dem Licht, den Bewegungen; und den Worten der Sprechenden. Was er oder sie nicht sagt, entzieht sich.
Manche Natur-Elemente aus dem ersten Erzählstrang, die man zuvor zwar hinnimmt, aber nicht weiter beachtet – wie zum Beispiel das Singen der Vögel, eine »ungereimte Melodie« (S. 8) – erleben viele Abschnitte später im zweiten Strang erst in ihrer Deutung Klarheit. So heißt es zum Beispiel: »[…] Vögel, die mit dem entrückten Egoismus der Jugend am Fenster sangen […]« (192)
Und wieso keine schlichten Intros, gefertigt mittels Narrativer Helfer?
Man könnte einwenden, dass die vorangestellten Naturdarstellungen mittels Narrativer Helfer ja auch neunfach vorangestellte Prologe sein könnten, die den Beginn eines jeweils neuen Abschnitts markieren, Intros quasi. Das hieße aber ihre Rolle als Erzählelement, welches in sich gleichfalls eine Einheit ergibt, minimieren und ignorieren. Und es hieße auch, die Bedeutung unbeachtet lassen, die Natur im Allgemeinen und der Garten im Besonderen in Virginia Woolfs Werk als Spiegel der Menschen und ihrer Empfindung haben – hierzu zwei Beispiele aus den »Wellen«: »Ich werde meine Seelenqual nehmen und sie auf die Wurzeln unter den Buchen legen.« (S. 11) »Der Abend öffnet seine Augen und wirft einen schnellen Blick zwischen die Büsche, bevor er einschläft.« (S. 179)
Allen Leser*innen sei der Genuss dieses experimentellen Romans, ein grandioser, meines Erachtens, dringend empfohlen: Nehmen Sie sich in diesem Jahr Zeit dafür. Er wurde nicht für flüchtige Leseauge geschaffen! Es bedarf vielmehr eines aufmerksamen Blicks, um zu verstehen, wie sich hier eines ins andere fügt. Mit leichtfertigem über die Seite huschen wird man nirgendwo ankommen. Oder höchstens in der Frustration. Das aber kann niemals im Sinne einer Literatin, eines Literaten sein. Für ein Huschen macht sich auch kein Mensch die gedankliche Arbeit der Komposition eines Romans, und Leseflucht hieße, die Kunstfertigkeit zu ignorieren. Was einzig dem Lesenden schadet. Insbesondere dann, wenn geschaffene Sätze solche Schönheit atmen. Dazu ein Beispiel: »Der Tropfen, der sich am Abend am Dach der Seele bildet, ist rund, vielfarbig.« (S. 63)
Abschließend sei zudem angemerkt: Dieser Roman enthält das schönste mir bekannte Bild für das Wachstum und das Altern darin: »So setzt das Sein Ringe an; die Identität wird robust.« (204) Einige Seiten später wird es in der wiederholten Variation zu: »Dienstag folgt auf Montag: Mittwoch, Dienstag. Jeder verbreitet dasselbe Wellengekräusel. Das Sein setzt Ringe an, wie ein Baum. Wie von einem Baum fallen Blätter ab.« (221)
Genießen Sie also das Spiel der Wellen!