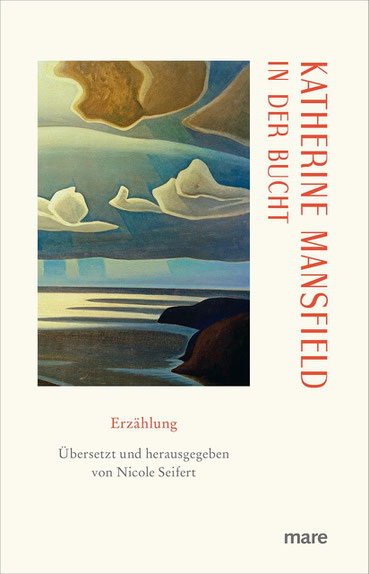
Die Erzählung beginnt mit einem auktorialen Blick über eine Meerlandschaft am frühen Morgen, leicht verregnet, in der noch keiner unterwegs ist, außer eine Schafherde samt ihrem Hütehund und ihrem Schäfer. Mit ungemein feinen Pinselstrich wird dabei eine Landschaft in Sprache lebendig.
Stanley Burnell kommt aus einem der Bungalows: »Das Wasser schäumt um seine Beine, als Stanley Burnell jubelnd hindurch watete. Erster, wie immer!« (S. 17) Mit diesen Worten wird er eingeführt und uns kaum sympathisch. Noch weniger, als er erbost darauf reagiert, dass ein anderer vor ihm bereits im Wasser ist und außerdem auch noch bereits ins Meer hinaus geschwommen ist: Jonathan Trout. Und der allwissende Erzähler oder die ebensolche Erzählerin mengt sich erneut ein: Stanleys »[…] Entschlossenheit, aus allem eine Aufgabe zu machen, hatte etwas bemitleidenswertes an sich. Man kam nicht umhin anzunehmen, dass er damit noch mal auf die Nase fallen würde!« (S. 20) Diesem Vorgriff auf Zukünftiges folgt die Erzählstimme trotzdem vorerst nicht weiter, sondern sie zieht – wie auch wir Lesenden selbst – Jonathans Gegenwart vor, der über Stanley ewige Verbissenheit nur den Kopf schütteln kann: »In diesem Augenblick hob eine enorme Welle Jonathan an, zog weiter und brach sich mit fröhlichem Lärm am Strand. Was für eine Schönheit! Und da kam schon die nächste. So musste man leben – unbekümmert, rücksichtslos, sich verausgabend. […] [D]ie Dinge leicht nehmen, nicht gegen das Auf und Ab des Lebens ankämpfen, sondern es zulassen – so musste man es machen. Diese Anspannung war vollkommen falsch. Leben – leben!« (S. 20) Und dennoch scheitert auch er: Jonathan erschöpft sich sogleich, denn sein ›Zulassen‹ kennt kein ›Fallenlassen‹ und ebenso wenig einen aktiven Gegenpol. An späterer Stelle heißt es über ihn, er habe keine Ambitionen (vgl.: S. 85), sei auch schon »[…] vom Alter angetastet […]« (S. 91)
Wir aber folgen dem ewig verbissenen Stanley in seinen Bungalow, indem er mit seiner Frau Linda und seinen Töchtern sowie seiner Schwägerin und seiner Mutter lebt. Die anderen Familienmitglieder kommen uns nach der Lebendigkeit des Meeres sogleich ruppig, unnahbar und selten leblos vor – als würden sie auf etwas warten. Vorerst kommt einem trotzdem nicht die Idee, dass es sich dabei schlicht um den Fortgang Stanleys handelt, der alle im Haus herumkommandiert, als wären sie seine Dienstboten: Die Frauen und die Mädchen einzig und allein zu seinem Komfort gedacht, schließlich bringe er ja die ›Brötchen‹ nach Hause: »Wie herzlos Frauen waren! Für wie selbstverständlich sie es hielten, dass man sich für sie abschufte, ohne sich ihrerseits auch nur die Mühe zu machen, den verlorenen Gehstock zu suchen.« (S. 28)
Kaum ist der Mann aus dem Haus, greift Erleichterung um sich (S. 29). Selbst das Dienstmädchen Alice lässt sich von diesem Aufatmen anstecken, »[…] tauchte die Teekanne in die Schüssel und hielt sie noch unter Wasser gedrückt, als es aufgehört hat zu blubbern, als wäre auch die ein Mann und ertrinken noch zu gut für sie.« (S. 30)
Und WIE die Frauen und Mädchen plötzlich zu Leben erwachen! Die Mädchen laufen zum Strand, genießen die Lebhaftigkeit des Meeres und hüpfen über die Schaumkronen der Wellen. Auch Beryl macht sich auf den Weg, um mit Mrs Harry Kember, einer modernen Frau, die sich wenig um tradierte Rollen kümmert und daher anderen im Dorf ein Dorn im Auge ist, den Tag zu genießen. Mrs Harry Kember – ihren Namen erfahren wir vorerst nicht – wird von den anderen Frauen, die in der Bucht wohnen, für »[…] sehr, sehr verwegen [gehalten]. Ihr Mangel an Eitelkeit, ihr Jargon, dass sie Männer behandelte, als wäre sie einer von ihnen, und die Tatsache, dass sie sich nicht das kleinste bisschen um ihr Haus scherte […], war empörend.« (S. 42) Und dennoch ist sie es, die Beryl, die sich auch vergnügen will, dazu rät, » keinen Fehler« zu machen (S. 47).
Auch Stanleys Frau Linda schafft es aus dem Bett, setzt sich mit dem jüngsten Kind in den Garten. Wer nun denkt, es würde uns in weiterer Folge ein Mutter-Kind-Idyll präsentiert, der irrt sich gewaltig: Linda hasst Kinder: »Es sagte sich leicht, dass es nun mal das Los von Frau sei, Kinder zu bekommen. Es stimmte nicht. Schon sie allein konnte das widerlegen. Sie war ruiniert, geschwächt, hatte jeden Mut verloren durchs Kinderkriegen. Und was es noch schwerer zu ertragen machte, sie liebte ihre Kinder nicht.« (S. 53) Doch nicht nur das, sie stehlen ihr auch tagtäglich die Zeit, eine Zeit, die so schnell vergeht, dass man nicht einmal die Blüten am Baum betrachten und kennenlernen könne, bevor sie welken (vgl.: S. 50)
Als Stanley abends zurückkommt, entschuldigt er sich wortreich, und wir verstehen zuerst gar nicht so recht, wofür. Er sei am Morgen gegangen, ohne sich von Linda zu verabschieden, das gesteht er ein, und als ihm dies tagsüber eingefallen sei, habe er sich selbst sogleich ein neues Paar Handschuhe gekauft (vgl.: S. 95) – diese Logik versteht wohl niemand außer ihm selbst. Seine Ruppigkeit hingegen, mit denen er seiner Frau und seinen Kindern den Lebensatem nimmt, die dünkt ihn offenbar normal.
Mrs Harry Kembers Mann, »[…] mindestens zehn Jahre jünger als sie und unglaublich attraktiv […]« (S. 43) ist es, der Beryl des Nachts zu einem gemeinsamen ›Spaziergang bis zu dem Fuchsienbusch‹ verleitet. Das Mädchen durchschaut zu spät, was er damit im Sinn hat. Angedeutet wird, dass es Beryl gelingt, sich ihm zu entwinden, bevor der Blick der Erzählerin des Erzählers erneut auf das Meer schwenkt, um es ein weiteres Mal zur bildlichen Darstellung des Seelenlebens der Figuren – dieses Mal für Beryl – zu nutzen:
»Eine Wolke, klein, gelassen, glitt vor den Mond. In diesem Augenblick der Dunkelheit klang das Meer tief, aufgewühlt. Dann segelte die Wolke fort, und der Klang des Meeres war ein leises Murmeln, als erwache es aus einem düsteren Traum. Alles war still.« ( S. 105)
Diese Technik setzt Katherine Mansfield wiederholt ein, auch um zu zeigen, wie zwiespältig Menschen oft sind – schön, düster und gefahrvoll zugleich: Der Menschen Worte widersprechen ihren Gedanken, ihrem Empfinden, ihren Taten, und ihre Körper erzählen nochmals anderes als ihre Sprache.
Was ich an Mansfield so ungemein schätze, ist ihr genauer Blick, der anhand winziger Details – wie das Welken einer Blüte – Relevantes über die Figuren und die Verhältnisse, in denen sie leben, zu sagen versteht. Und dies tut Mansfield obendrein in einer ungemein poetischen und dennoch höchst unprätentiöse Sprache: Chapeau!
Überaus lesenswert ist auch das Nachwort der Übersetzerin und Literaturwissenschafterin, das diese schön gebundene Ausgabe (Gestaltung Nadja Zobel und Petra Koßmann) im Schuber zu einem wahrhaft schönen Geschenk macht – für einen lieben Menschen, der gleichfalls über die Gespaltenheit der Menschen Bescheid wissen. Oder auch für einen selbst – ein wundervolles Buch, nicht nur des handlichen Formats wegen, besonders für Reisen!
Katherine Mansfield: In der Bucht. Erzählung. Aus dem Englischen übersetzt und mit einem Nachwort von Nicole Seifert. Hamburg: Mare Verlag 2025.