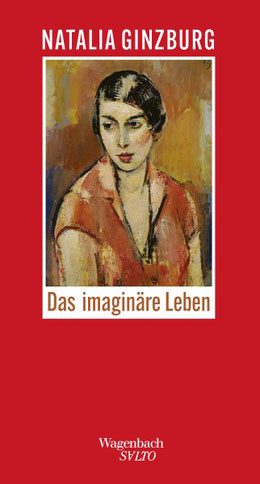
Es sind Wortbilder wie diese im Titel, welche die Lektüre des schmalen, bei Wagenbach Salto erschienen Buches mit gesammelten Essays Natalia Ginzburgs (1916–1991) so besonders machen. So manche der darin versammelten Erzählungen beginnt mit der Wendung ›ich denke‹, und so führen bereits ihre ersten Worte in die Etablierung eines gedanklichen, imaginierten Raumes. In diesem finden sich die Wirklichkeiten eines Kindes denjenigen gegenüber gestellt, die wir Erwachsene als Realitäten und Lebensräume erkennen; dem Dazwischenliegenden aber wird nachgespürt. So denken wir als Kind zum Beispiel noch, dass es einfach sei, zwischen Opfer und Unterdrücker*innen zu unterscheiden, um als Erwachsene alsdann festzustellen, dass nicht nur stets eine noch schlimmere Situation irgendwo anders existiert, obendrein hinter jedem Unterdrücker, jeder Unterdrückerin oft ein System steht, eine Institution, eine Macht, eine Interessenverflechtung, sodass final auch die Schuldigen weniger schuldig sein könnten, als sie es uns primär dünkten. Und sollten wir es dennoch nicht glauben, wird man es uns so oft sagen, bis wir unseren eigenen Maßstab von Gut und Böse anzweifeln (Vgl.: S. 24). Nur eines sei über jeden Zweifel erhaben, und zwar die Tatsache, »[…] dass die Welt, in der wir leben müssen, Tränen verdient […]«, weshalb wir sicherlich keinen Fehler machen, weinen wir über sie (S. 26).
Mir scheint auch, ich habe selten eine so treffende und humorvoll-ironische Darstellung dessen gelesen, was es bedeutet, ›eine Frau mittleren Alters‹ zu werden: »[…] jenes lächerliche, unsympathische und traurige Tier […]« (S. 42), das sich danach sehnt »[…] mit rasender Geschwindigkeit bis zur Erde gebückte, weißhaarige alte Frauen zu werden. Sie träumen von schlohweißen, lockigen Haaren, aufgelöst wie die Wollfüllung der Matratzen. Denn dann werden sie nicht mehr schwer auszuhalten und lächerlich sein, sondern Verehrung würdig und freundlich niemand wird mehr an ihnen die Zeichen des Alters feststellen, weil sie das Alter schlechthin verkörpern werden.« (S. 42)
Leider – für meinen ruhelosen Geist – sind viele der Beschäftigungen des Alters, die unsere Ahninnen noch ausübten, wenig erfüllend, mal abgesehen vom Toben und Tollen mit den Enkel*innen (»Was die Frauen früher zu tun pflegten, wenn sie alt waren, auf die Enkelkinder aufpassen und Deckchen und Kissen sticken, hat sich zum Teil als vollkommen nutzlos, zum Teil als notwendig, aber nur provisorisch und zufällig notwendig, herausgestellt.« (S. 45)).
Übrigens, ich bin überzeugt, dass Ginzburgs »Imaginäres Leben« mit Sicherheit die schönste Definition des Wortes ›stopfen‹ enthält, sicherlich einzigartig in der Weltliteratur:
»Es bedeutet, sich mit Liebe über Gegenstände beugen.« (S. 48), schreibt die Autorin, und es sei bedauerlich, dass dieses Wort nach und nach aus unserem Wortschatz verschwinde, »weil die Gegenstände nicht mehr geliebt, sondern gehasst werden«. (S. 48) Ich denke an den Soziologen Hartmut Rosa und an seine Theorie, dass erst durch Langjährigkeit, Stopfen und Flicken ein Pullover zu unserem Pullover werde, er seinen Charakter als Objekt von der Stange verliere …
Immer wieder finden sich im Nachspüren der Zusammenhänge zwischen kindlicher und erwachsener Weitsicht kluge Sätze, die man sich unterstreichen möchte wie diesen: »[…] über unsere Reaktionen auf Tatsachen, die uns im Erwachsenenleben geschehen, breitet sich auf seltsamerweise ein geheimes Spinnennetz, welches aus unseren Kindertagen geboren ist; und im Halbschatten unserer Seele gedeiht eine Flora und eine Fauna, die keinerlei Beziehungen zu unseren im Lauf der Zeit gereiften Überzeugungen, zum Denken und zur Vernunft hat.« (S. 31)
Überraschend modern sind viele ihrer Gedanken – so findet sich in diesem Band eine Kritik an der Autoflut, die verhindert, dass man die Schönheit von Städten wie Rom überhaupt noch wahrnehme, und man würde sich wünschen, dass Menschen es sich – vernünftige Wesen, die sie sind (oder sein könnten) – zu Herzen nehmen und demgemäß handeln. Gleiches gilt für diesen Gedanken: »Vielleicht wäre es richtig und notwendig, daß jeder nicht an seine eigene Freiheit dächte, sondern an die der anderen.« (S 62)
Mit diesen treffenden Statements in ihren ganz allgemein sehr klugen Essays, die sich am eigenen Leben entlang erzählen, verschafft sie uns Einblicke – nicht nur in ihr Denken, sondern auch in unsere eigenen Gedanken, die sich zustimmend oder ablehnend, vielleicht auch befragend entwickeln. Literat*innen jedenfalls dürften sich darin wiedererkennen: »Als Kinder und als Jugendliche bedeutete für uns allein sein und nichts zu tun zu haben, uns sofort imaginäre Orte und Begebenheiten und Geschichten auszudenken, deren Protagonisten wir waren. Orte und Geschichten füllten wir mit Personen, von denen manche erfunden, manche aus unserem wirklichen Leben ausgewählt waren. In der Kindheit überwogen die erfundenen Personen, und wir hatten den Eindruck, unsere Szenarien für sie aufzubauen.« Für dieses imaginäre Leben beginnen sich viele Menschen mit der Zeit zu schämen, auch weil wir begreifen, dass andere im Laufe der Jugendjahre darauf verzichten, sodass uns dieses »[…] so seltsam[e], so lächerlich[e], so demütigend[e] Geheimnis […]« allein sein lässt (S. 83), bevor Kreative es als Talent zu kultivieren lernen, insbesondere wenn auf erste Bild- oder Schriftlichkeit ein bestärkendes Echo erfolgt. Oder wenn wir begreifen, dass es dazu in der Lage ist, »[…] alles unterzubringen, was unserem wirklichen Leben fehlte oder wovon es zu wenig gab […]« (S. 85). So wird das imaginäre Leben für uns zur stärkenden »Turnhalle« (S. 86) für das wirkliche Sein, da wir darin Varianten und Facetten möglicher Lebensentwürfe erproben können, unsere ›Muskeln‹ der Imagination stärken. Ginzburg sieht diese Fähigkeit aber nicht ausschließlich positiv: »Wenn wir sie einander gegenüber stellten, dass imaginäre und das wirkliche Leben, schauderte uns von den Unterschieden zwischen beiden.« (S. 86) Denn während wir uns in Kindheitsträumen in Samt und Seide kleideten, setzte unsere Jugend uns in gefährliche Situationen, in » Ströme von Unglück« (S. 89), für die es keine Lösungen gab, und die Italienerin schließt mit dem Gedanken die Tür, dass daraus nichts entstanden sei (S. 92) – dem kann ich in dieser Absolutheit nicht zustimmen. Wohl aber der Erkenntnis, dass ohne dieses imaginäre Leben der Weg zum »schöpferischen Leben« (S. 92) schwerer gewesen wäre oder wir ihn gar nie gefunden hätten. Für mich persönlich war das imaginäre Leben der Weg, um mit alldem, was mir geschah und was ich problematisch, schwierig oder unverständlich fand, umzugehen – zu überleben, also. Und so gilt für mich, was Ginzburg in einem anderen Essay schreibt: »Wir kämpfen das ganze Leben, um uns von den Lasten unsere Erziehung zu befreien, die Lasten der Erziehung bleiben in unserem Geist eingeritzt wie Tätowierungen. In unserem erwachsenen Leben verbringen wir die Zeit damit, diese Tätowierungen von unserem Geist abzuwaschen.« (S. 75) Das aber, so denke ich, ist schlicht die Aufgabe unseres erwachsenen Lebens: Nicht mehr andere für unsere Unbill verantwortlich zu machen, sondern aus Vergangenheiten lernen und die Gegenwart gestalten. Nichts anderes bedeutet in meinen Augen ›erwachsen werden‹, als diese Verantwortung für unser Sein übernehmen.
Natalia Ginzburg: Das imaginäre Leben. Aus dem italienischen von Maja Pflug. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach.