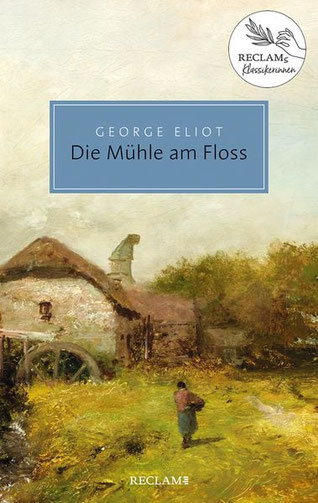
Ich bin überzeugt: Keiner bedarf einer Zusammenfassung des Inhalts dieses Romans – es genügen ja heutzutage einige wenige Klicks und schon hat man die Qual der Wahl, welche Inhaltsangabe man sich zu Gemüte führen möchte.
Spannend aber bleibt die Literatin für uns bis zum heutigen Tag. In vielen ihrer frühen literarischen Arbeiten greift sie autobiografische Themen auf: So spielt »Scenes of Clerical Life« (1858) in George Eliots Kindheitswelt und »Adam Bede« (1859) thematisiert die Jugendjahre ihres Vaters. In »Die Mühle am Floss« steht ein Konflikt mit ihrem Bruder im Hintergrund. George Eliot oder eigentlich Mary Ann Evans (1819–1880) litt von Kindheit an darunter, nicht hübsch zu sein, somit eines der wichtigsten Ziele im Leben eines Mädchens – die Ehe – wohl zu verpassen. Daran änderte es auch nichts, dass sie klug war – vielleicht zu klug, denn im Ton ihrer Zeitgenossen sagte man ihr, sie habe den Verstand eines Mannes; der aber änderte nichts daran, dass sich für sie ›nicht-schön-genug‹ oftmals als ›nicht-gut-genug‹ anhörte: Heiraten werde sie jedenfalls keiner, besser sie schule ihren Intellekt. Und es fügte sich gut, dass in dem herrschaftlichen Besitz, für den ihr Vater als Verwalter arbeitete, eine recht umfangreiche Bibliothek vorhanden war, die Mary Ann Evans / George Eliot nutzen durfte.
Dass es final nicht zur ewigen Jungfernschaft samt Einsamkeit und Abhängigkeit kam, das lag an einem Mann, von dem man sagte, er sei der hässlichste Mann von ganz London. Lewes war jedoch bereits verheiratet. Seine Frau Agnes hatte drei Kinder – mit seinem Freund. Doch da Lewes sie einst anerkannt hatte, konnte er sich nun – wegen einer Sehnsucht nach eigenem Glück – auch nicht scheiden lassen. Und die mutige George Eliot entschied sich daher für eine wilde Ehe, ein Zusammenleben mit Lewes in London, das bis zu seinem Tod dauerte. Wofür sie der eigene Bruder schnitt und Gleiches den Schwestern zu tun befahl. Ein Zerwürfnis, das sich im Gegensatz zum dargestellten Konflikt in »Die Mühle am Floss« nie wieder wird befrieden lassen. Dass die Beziehung mit Lewes George Eliot gestattete, am intellektuellen und künstlerischen Leben teilzunehmen, wiewohl das zu ihrer Zeit keineswegs für eine Frau vorgesehen war, konnte den Bruder nicht versöhnlich stimmen.
George Eliot ist auch deshalb beindruckend, weil es ihr gelang, mit ihrem Schreiben die eigene Freiheit zu finanzieren. »Writing is Part of my religion«, schreibt sie in einem Brief und fährt fort: »[A]t the same time I believe almost all of the best books in the world have been written with the hope of getting money for them.« Der Gedanke, dass Schreiben Arbeit sei und sie das Sein finanziere, beginnt in jenem Jahrhundert seinen Weg, auch wenn es noch dauern wird, bis die Erkenntnis, dass die nötige Konzentration darauf, wolle Relevantes geschaffen werden, kein Nebenher gestattet, auch von umgebenden Menschen verstanden werden kann.
Den Nom de plume übrigens schuf sie sich, um keine Liebesromane verfassen zu müssen, aber auch um ihr Privateben privat zu halten. Niemals hätte die viktorianische Gesellschaft ihre Romane goutiert, hätte man begriffen, dass eine Frau in wilder Ehe sie verfasst hatte. Als ein Mann dies ausnützt und ihre werke als die seinen ausgibt, protestiert sie vehement dagegen – und die Fan-Post, die ist alsdann erreicht, beweist ihr, dass viele sich in den Werken wiedererkennen, sich in ihnen gesehen und gehört fühlen.
Als sie nach Lewes Tod den fast zwanzig Jahre jüngeren John Cross (1840–1924), einen langjährigen Freund des Ehepaares, heiratet, schreibt ihr Bruder Isaac ihr zum ersten Mal wieder und gratuliert ihr: Endlich ist sie eine respektable Frau!
Eliot, George: Die Mühle am Floss. Übersetzt von Eva-Maria König. Leipzig: Reclam 2022.